App installieren
How to install the app on iOS
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
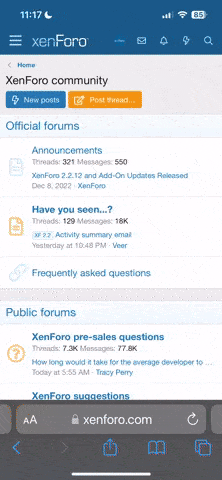
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
-
Wichtige Änderungen an der Datenschutzerklärung. Mit der fortgesetzten Nutzung des Forums bestätigst Du die neuen Datenschutzrichtlinien. Bisher waren eingeschränkt Einbettungen in Posts möglich, teilweise wenn man zuvor explizit in den Einstellungen zugestimmt hat. Mit jeder Änderung der Soziale-Medien-Landschaft wird es schwieriger, alles mit eigenen Codes up-to-date zu halten und zusätzliche Dienste zu aktivieren. Ich habe daher standardmäßig über s9e eine Reihe an Diensten aktiviert - s9e aktualisiert die Codes, wenn sich etwas an den Diensten ändert. Folgende Drittanbieter sind nun also aktiv: s9e.github.io (Github), Youtube, Vimeo, Bluesky, Mastodon, Threads und Facebook. Details in der Datenschutzerklärung. (Dieser Hinweis kann über das X oben rechts ausgeblendet werden)
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
- Ersteller Igor07
- Erstellt am
- Link in Zwischenablage kopieren Link in Zwischenablage kopieren
mkha'
Mitglied
Buddh. Richtung:
Tib. Buddh. - Gelug
Tib. Buddh. - Gelug
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Deine Frage beantwortet Dir korrekter einer unserer Theravadin, aber schau mal, @Igor07, vielleicht magst Du das lesen, wenn Du die Zeit dazu findest: https://docplayer.org/45885889-Wie-die-lehre-von-der-buddhanatur-entstand.html. LG mkha'
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Wow, sehr toller Artikel, @mkha' .Deine Frage beantwortet Dir korrekter einer unserer Theravadin, aber schau mal, @Igor07, vielleicht magst Du das lesen, wenn Du die Zeit dazu findest: https://docplayer.org/45885889-Wie-die-lehre-von-der-buddhanatur-entstand.html. LG mkha'
Ich denke , es sei der springene Punkt. Denn Theravada- Schüler sollte für die eigene Befreiung kämpfen, also um seine Erlösung. ( nach V. Zotz). Also im Mahayna man sollte nur jeder die eigene Natur aber nur ent-deck-en. Die ist schon ( wie immer ) anwesend ist. Das ist genau das Problem, wie ich im Moment sehe. Ist es korrekt, oder? LG.Inhaltlich sind in dem Zitat alle wesentlichen Punkte der
Lehre enthalten: Alle Lebewesen tragen einen Buddha insich, erkennen es jedoch nicht. Unmittelbar ist dieser Buddha
ja auch nicht zu sehen, denn er ist eingehullt von
den Befleckungen emotionaler und intellektueller Naturist, und belehrt die Lebewesen uber ihre Buddhanatur.
der Lebewesen. Deshalb erscheint der Buddha, der mit
seinem Allwissen uber die wahren Verhaltnisse im Bilde
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
So, genau das! Super! Jetzt würde mich die Meinung von Theravada , wie @mukti , intereressieren.Dass die Beseitigung von Befleckungen
bei den Lebewesen in den Befreiungsprozess
mit aufgenommen wird, zeigt, dass doch
eine Grenze zwischen gewöhnlichen Lebewesen und
Buddhas gezogen wird. Diese betrifft aber nicht das wahre
Wesen aller Beteiligten, denn die Befleckungen haften der
Buddhanatur, so wie die dreckigen Lumpen die wertvolle
Buddhastatue verhüllten, nur vorübergehend an.
Es gibt im Pali -Kanon sehr interessante Stelle:
A.I.11. Das lautere Bewußtsein II (VI,1-2)
Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewußtsein; doch es wird [zuweilen] verunreinigt von hinzukommenden Befleckungen. Doch der unkundige Weltling (*1) versteht dies nicht der Wirklichkeit gemäß. (*2) Darum, sage ich, gibt es für den unkundigen Weltling keine Entfaltung des Geistes. (*3)
Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewußtsein; und [zuweilen] ist es frei von hinzukommenden Befleckungen. Der kundige, edle Jünger aber versteht dies der Wirklichkeit gemäß. Darum, sage ich, gibt es für den kundigen, edlen Jünger eine Entfaltung des Geistes. (*4)
Im Kommentar lese ich:
(*2) K: Er weiß nicht, daß das Unterbewußtsein in dieser Weise von den hinzukommenden Befleckungen verunreinigt oder auch frei sein kann.
Aha, so Anālayo Bhikkhu . Sehr klar. Ich markiere, was ich meine.Das Sa&hipa&&hāna-sutta und seine Parallelen zählen verschiedene Geisteszustände für die
achtsame Kontemplation auf, indem sie z.B. unterscheiden zwischen einem
leidenschaftlichen Geist, sarāga+ citta+, und einem Geist frei von Leidenschaft, vītarāga+
citta+.69 Der auf diese Weise hergestellte Kontrast zwischen „mit Leidenschaft“ und „ohne
Leidenschaft“ beweist, dass das frühbuddhistische Denken durchaus imstande war, die
Möglichkeit geistiger Reinigung und die Freiheit von den Verunreinigungen auszudrücken,
ohne eine essentielle Natur des Geistes postulieren zu müssen, welche von den
Verunreinigungen prinzipiell unberührt wäre. Bildhaft gesagt, damit eine Frucht reifen
kann, ist es nicht notwendig zu postulieren, dass die reife Frucht bereits in der Blüte
vorhanden sei, welche soeben am Baum erblüht ist. Ebenso wenig ist es für die Reinigung
des Geistes nötig, zu postulieren, dass eine innewohnende Reinheit bereits in ihrem
aktuellen verunreinigten Zustand vorhanden sei. Anstatt den Kontrast zu erschaffen
zwischen einer angeblich innewohnenden Natur des Geistes und seinen hinzugekommenen
Verunreinigungen, erscheint im Satipa&&hāna-sutta und in anderen frühen Lehrreden der
Geist einfach als ein unbeständiger und bedingter Prozess, der entweder „mit“ oder „ohne“
Verunreinigungen stattfinden kann. Hier meint citta einfach einen abhängigen, geistigen
Zustand.
Weiter.
Dasselbe gilt für die Aussage über den leuchtenden Geist in der Passage des A<guttara-
Nikāya, die oben übersetzt wurde, worin „Geistesentfaltung“ für die Entfaltung der
Konzentration steht. In seiner gegenwärtigen Formulierung impliziert die Leuchtkraft keine
Form des Erwachens.76 Karunaratne (1999: 219) betont:
Was unter strahlendem und reinem Geist (pabhassara/ prak3tipariśuddha) gemeint ist, ist
nicht ein absolut reiner Geistzustand, nicht der reine Geist, der gleichbedeutend mit
Befreiung ist. Er kann nur in dem Sinn und in dem Maß als rein erklärt werden, als er
nicht von äußeren Reizen beeinflusst und gestört wird.
Auf ähnliche Weise erklärt Shih Ru-nien (2009:168):
Die Pāli-Texte betonen nur das Wissen von der angeborenen Reinheit des Geistes als
eine Vorstufe für die Geistesentfaltung, und die Wiederherstellung der Reinheit des
Geistes ist nicht das Ende der religiösen Praxis. Es ist eine Tatsache, dass nach der
Entfernung der Verunreinigungen der Geist nicht nur rein, beruhigt und leuchtend ist,
sondern auch weich, fügsam und anpassungsfähig. So wird er geeignet für die
Vernichtung aller āsavas, oder die Entfaltung der sieben Weisheitsglieder u.Ä. Das
heißt, dass der beruhigte, leuchtende und fügsame Geist bloß die Grundlage ist für
weitere spirituelle Praxis
Nichts sehr klar, also es wäre dann die Frage der Übung, oder schon als die "inhärente" ( inne-wohnend-e) "Reinheit"?Die relevante Stelle verläuft wie folgt:82
Der Geist ist naturgemäß rein; er wird verunreinigt durch hinzukommende
Verunreinigungen. Da er unkundig ist, ist ein Weltling unfähig, das der Wirklichkeit
gemäß zu erkennen und zu sehen und er bringt den Geist nicht zur Entfaltung.
Der Geist ist naturgemäß rein; er ist befreit von hinzugekommenen Verunreinigungen.
Da er kundig ist, ist ein edler Schüler fähig, das gemäß der Wirklichkeit zu erkennen
und zu sehen und er bringt den Geist zur Entfaltung.
Also, wieder, geht es hier um das Ergebnis von Geister-Training, oder?Die Faszination der sich daraus ergebende Darstellung hat offensichtlich einen bedeutenden
Einfluss auf spätere Traditionen gehabt, und zwar sowohl im Mahāyāna wie im Theravāda.
Weitere Entwicklungen des Begriffs einer ursprünglichen Reinheit brachten schließlich
Ansätze von Geistesentfaltung hervor, die die Wichtigkeit betonen, seine angeblich wahre
Natur zu erkennen, was dem Erwachen gleichkommt.
Das ist die Quelle:
Anālayo Bhikkhu
Der leuchtende Geist in den Lehrreden der Theravāda und Dharmaguptaka Schriftensammlung
Kategorie(n): Geist
veröffentlicht September 2019
In diesem Artikel untersuch Bhikkhu Anālayo die in den Pāli-Lehrreden enthaltenen Aussagen über die Leuchtkraft des Geistes im Licht ihrer Parallelstellen. Ziel ist es, die frühen Entwicklungsstufen eines Begriffs deutlich werden zu lassen, der einen erheblichen Einfluss auf das buddhistische Denken und die buddhistische Praxis hatte.
› Schreiben Sie eine Buchrezension!
› Mehr über den Autor erfahren
Bücher - Dhamma Dana
mukti
Mitglied
Buddh. Richtung:
Theravada
Theravada
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Soviel ich weiß ist "Buddhanatur" ein Konzept des Mahayana das weder im Palikanon noch in den klassischen Theravada-Kommentaren vorkommt.Jetzt würde mich die Meinung von Theravada , wie @mukti , intereressieren.
Die von Dir zitierte Lehrrede ist sehr kurz, ich weiß nicht was das genau bedeutet. Nach dem Kommentar geht es jedenfalls nicht um eine Buddhanatur:
Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewußtsein; doch es wird [zuweilen] verunreinigt von hinzukommenden Befleckungen. Doch der unkundige Weltling (*1) versteht dies nicht der Wirklichkeit gemäß. (*2) Darum, sage ich, gibt es für den unkundigen Weltling keine Entfaltung des Geistes. (*3)
Lauter, ihr Mönche, ist dieses Bewußtsein; und [zuweilen] ist es frei von hinzukommenden Befleckungen. Der kundige, edle Jünger aber versteht dies der Wirklichkeit gemäß. Darum, sage ich, gibt es für den kundigen, edlen Jünger eine Entfaltung des Geistes. (*4)
A.I.10
(*1) 'Lauter' (pabhassara), wtl: leuchtend; K: hell, rein. -
'Der Geist' (citta) , im K mit 'Unterbewusstsein' (bhavanga-citta) erklärt. -
'Durch hinzukommende' (āgantukehi); K: d.h. nicht durch (mit dem Unterbewusstsein) zusammen entstandene, sondern erst später im Impuls-Stadium (des Wahrnehmungsprozesses; javana, aufsteigende 'Befleckungen' (upakkilesehi), wie Gier usw.
Der vorhergehende Text 9 vom "schnellen Wandel des Bewusstseins" macht es klar, dass mit dem "lauteren Geist" nicht etwa ein "ewiger, lauterer Seelengrund" gemeint ist.
.....
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Ich habe diese Frage BGM-Vorstand gestellt, vor langen zeit, per email. Er sagte mir sehr klar und ein-deutig, es geht hier ausschliesslich um das Resultat von der sehr tiefen Versenkung, Ent-Rückungen , samadhi , usw.. Keine Buddha-Natur im Theravada. .Die von Dir zitierte Lehrrede ist sehr kurz, ich weiß nicht was das genau bedeutet. Nach dem Kommentar geht es jedenfalls nicht um eine Buddhanatur:
Wahrscheinlich , ich vesuche so etwas bei PD in diese Richtung zu finden. Aber rein historisch gesehen, der Begriff gehört nur Mahayna. Ich bewerte es nichts, ich konstatiere es, mehr nichts. Danke, @mukti

Über den Buddhismus
Was man seit ca. 150 Jahren als „Buddhismus “ bezeichnet, geht auf den Buddha Shakyamuni (ca. 480 – 400 v.u.Z.) zurück.
Zuletzt bearbeitet:
kilaya
Moderation
Buddh. Richtung:
Dzogchen
Dzogchen
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Ich stelle mir zum Einen die Frage, ob dieser Schluss zwingend der einzige mögliche Schluss ist. Ich habe mir Text 9 angeschaut, der letztlich nicht mehr aussagt als "nichts wandelt sich so schnell wie das Bewusstsein".Der vorhergehende Text 9 vom "schnellen Wandel des Bewusstseins" macht es klar, dass mit dem "lauteren Geist" nicht etwa ein "ewiger, lauterer Seelengrund" gemeint ist.
Zum Anderen ist Buddhanatur (im Mahayana) kein "ewiger, lauterer Seelengrund" im Sinne von etwas Individuellem, das eine eigenständige Existenz hat. Buddhanatur ist das jedem Wesen innewohnende Potenzial, ein Buddha werden zu können. Dieses kann mehr oder weniger unter den Trübungen verschüttet sein, was es dem "unkundigen Weltling" unmöglich macht, dies zu entfalten. Wie auch, wenn man "unkundig" ist, also gar nicht auf die Idee kommt, sich darum zu bemühen? Während der kundige Jünger die im schnellen Wechsel des Bewusstseins auftauchenden klaren Momente als solche erkennen und kultivieren kann, eben weil er "kundig" ist, die Lehre kennt.
Ich frage mich also, ob die Ablehnung des Begriffs "Buddhanatur" nicht letztlich auf einem falschen Verständnis dieses Konzepts beruht. Ich würde das, was in A1.10 steht, durchaus als Hinweis auf ein ähnliches Denken sehen, auch wenn das keine zentrale Rolle im Theravada einnimmt. A1.9 lese ich bedingt als etwas, das einen "ewigen, lauteren Seelengrund" ausschließt, aber als nichts, was das ausschließt, was "Buddhanatur" tatsächlich meint.
Ob ich nun sage: "ich erreiche durch Versenkung usw. einen Zustand ohne Geistestrübungen" oder "wenn ich die Geistestrübungen überwinde, zeigt sich die ursprüngliche Versenkung des Geistes" ist aus meiner Sicht einfach nur eine Frage, von welcher Seite man das gleiche Pferd aufzäumt. Genaugenommen ist selbst diese Formulierung von mir nur ein semantischer "Trick", denn auch auf dem Theravada-Weg arbeitet man doch an einer Vertiefung der Versenkung und einer Aufgabe der Geistestrübungen parallel, oder? Und im Mahayana ist es nicht wirklich anders, nur mit anderen Methoden und Vorstellungen.
Zuletzt bearbeitet:
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Richtig, das ist auch ( im Prinzip) meine Frage.Ich frage mich also, ob die Ablehnung des Begriffs "Buddhanatur" nicht letztlich auf einem falschen Verständnis dieses Konzepts beruht. Ich würde das, was in A1.10 steht, durchaus als Hinweis auf ein ähnliches Denken sehen, auch wenn das keine zentrale Rolle im Theravada einnimmt. A1.9 lese ich bedingt als etwas, das einen "ewigen, lauteren Seelengrund" ausschließt, aber als nichts, was das ausschließt, was "Buddhanatur" tatsächlich meint.
Im Einem Buch, so:
Wilhelm K. Essler, Ulrich Mamat: Die Philosophie des Buddhismus. 1. Auflage. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2005, ISBN 3-534-17211-6.
Die Autoren erklären es so, dass es einfach nichts möglich wäre, den "Ur-grund" ( so wie die "Reinheit") von den Befleckungen, also kilesa zu unterscheiden, zu trennen, es funktioniert nut bei sehr tiefen Samadhi, dazu man sollte so oder so auch berücksichtigen, dass es auch bei sehr tiefen Versenkungen die Triebe ( Geistes-Gifte) wären nur unterdrükt, aber nichts endgültig behoben.
Am Ende, also rein praktich, es ist egal, denke ich. Aber Hinayana geht davon aus, dass es keinen so wie unreinen Grund überhaupt gibt, so der Unterschied.Und im Mahayana ist es nicht wirklich anders, nur mit anderen Methoden und Vorstellungen.
Der Buddha vernichtete die Triebe nur durch die absolute Einsicht , also Panna, und das ist für den Otto-Normalen kaum möglich.
Nyanatiloka benutzt dann das wie das Modell von dem "Un-bewussten", so wie der karmische Impuls drin, der weiter in die nächte Existenz wandelt. Und mit dem ganzem "Schmutz " von diesem Leben, grob ausgedrückt.
Klar, @kilaya , mann kann das ganze als die Haar-Spalerei betrachten,
aber die eine sache wäre, sollte ich nur das ent-deck-en, was in mir schon ( wie immer) vorhanden ist,
oder sollte ich mich für (um) die meine Erlösung ( Befreiung) kämpfen? ( so V. Zotz, "Die Geschichte der Buddh- Philosphie).
Der andere Zugang bestimmt anders meine Praktik, und das wäre schon entscheidend.
Deswegen ich hatte überrhaupt diese Frage gestellt. LG.
kilaya
Moderation
Buddh. Richtung:
Dzogchen
Dzogchen
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Ich denke, das größte Missverständnis steckt darin, dass versucht wird, aus einem "Urgrund" oder "Buddhanatur" usw. ein Phänomen zu machen - weil es einen Begriff dafür gibt. Aber die Begriffe zeigen nicht auf ein Phänomen. Das wird auch explizit erklärt. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch von den meisten Mahayana-Buddhisten als Phänomen, oder "Ding", verstanden wird. Das liegt einfach an der Gewohnheit unseres Geistes, mit einem Begriff benanntes als "Ding" zu begreifen. (Interessant: Be-griff - be-greifen)
Ich habe im Chat die KI gefragt, die diese Aussage untermauert:
Ich habe im Chat die KI gefragt, die diese Aussage untermauert:
kilaya:
/ai ist "Buddhanatur" im Verständnis des Mahayana-Buddhismus ein Phänomen bzw. etwas dingliches? Ist sie "ewig" im Sinne einer Existenz als "Ding"?
ChatGPT:
Im Verständnis des Mahayana-Buddhismus wird "Buddhanatur" als ein grundlegendes Potenzial oder eine inhärente Qualität betrachtet, die in allen Lebewesen vorhanden ist. Es wird oft als das Potenzial zur Erleuchtung oder zur Verwirklichung des Buddha-Natur betrachtet.
Die Buddhanatur wird nicht als etwas Dingliches oder Phänomenales angesehen, sondern als eine Art von Leerheit, die frei von jeglicher Dualität oder Begrenzung ist. Sie wird als das unveränderliche und zeitlose Potenzial betrachtet, das es jedem Lebewesen ermöglicht, Erleuchtung zu erlangen.
In Bezug auf die Frage der "Ewigkeit" wird die Buddhanatur im Mahayana-Buddhismus nicht als etwas betrachtet, das eine ewige Existenz als "Ding" hat. Vielmehr wird sie als etwas betrachtet, das jenseits von Zeit und Raum existiert und nicht von den Begrenzungen der konventionellen Existenz betroffen ist. Es wird oft betont, dass die Buddhanatur unvergänglich ist, aber nicht ewig im Sinne einer dauerhaften Existenz als Ding.
Es ist wichtig anzumerken, dass verschiedene Schulen und Traditionen des Mahayana-Buddhismus unterschiedliche Interpretationen der Buddhanatur haben können. Die obige Antwort gibt eine allgemeine Erklärung, aber es kann Variationen geben.
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
So PD zur ganzen Problematik:
Und das würde dem entspechen, was Nyanatiloka sagt.. man kann den so "Ur-grund" von dem "Schmutz " nichts trennen.
Aus: Paul Debes, "Die Lehrreden des Buddha", Band 1, Seite 390 - https://www.buddhistisches-seminar.de/
Der Prozess des "Bhava" ist immer durch die "Triebe" bestimmt und wie gesstuert, so ich verstehe das.Durch jede Berührung der Gegebenheit der fünf im Körper
inkarnierten Sinnesdränge wird die Gegebenheit: der von ihnen
erfahrene Gegenstand (Form, Ton usw.) - und die Gegebenheit
der Gefühlsantwort der Triebe zusammen in den Geist
eingetragen. Die Dränge in den Sinnesorganen und im ganzen
Körper erfahren die Gegebenheit Wohlgefühl, wenn sie von
dem Gewünschten berührt werden, und erfahren die Gegebenheit
Wehgefühl, wenn das Gegenteil des Ersehnten ankommt.
Diese Gegebenheiten: Gefühlsurteile der Triebgeschmäcke -
Wohlgefühl bei den den Trieben angenehmen Erscheinungen,
Wehgefühl bei den den Trieben unangenehmen Erscheinungen
- sind eine Entstellung und Verzerrung der Gegebenheit Erfahrung,
die, solcherart subjektiv gefärbt, als Wahrnehmung in
das Gedächtnis eingetragen wird. Wahrnehmung allein besteht
schon aus drei Dingen: Form und Gefühl wird wahrgenommen.
Der Geist, das Gedächtnis kennt gar nichts anderes als
die gefühlsbesetzten Eintragungen der Triebe. Diese gefühlsbesetzten
Wahrnehmungen, von welchen wir leben, durch
welche wir an Ich und Welt und Dasein glauben, sind - wie ein
Traum - ein geistiger Vorgang, entstanden aus den Gegebenheiten
der Triebe und der Gegebenheit des als außen Geschaffenen.
Die Wahrnehmungen, Bewusstwerdungen, hält der
Geist fest und ordnet immer die neue in die schon bestehenden
ein. So haben wir im Geist ein Kontinuum, das wir als Erinnerung
bezeichnen. Jede Erinnerung ist Inhalt einer Wahrnehmung.
Aber nicht alles, was gewirkt ist, ist schon in der Wahrnehmung.
Das meiste ist noch nicht im Erleben, ist uns noch
nicht zugänglich, ist im bhava, in der Latenz.
Also, nochmal, die Wahrnehmung ist von dem Gefühl wie durchgetränkt... Aber die Wahrnehmung ist nichts anderes als" Ich-Wahn", also aus dieser Position heraus, die Lampe ist immer schmutzig, nur im Nirvana der Prozess des Werdens wäre auf immer beendet.Ein Mönch des Erwachten, Nandako, veranschaulicht in
einem Gleichnis (M 146), wie an der Wahrnehmung des Geistes
die beiden Wurzeln der Existenz beteiligt sind: die Triebe
und das als außen Gewirkte. Nandako vergleicht den lebenden
Menschen mit einer brennenden Öllampe. Das Öl in der Lampe,
das den ganzen Docht (Gleichnis für die körperlichen Sinneswerkzeuge)
durchzieht, gilt für die fünf Begehrensdränge,
die die Sinnesorgane durchziehen, und gilt als sechstes auch
für den das Gehirn durchziehenden geistigen Drang nach gedanklicher
Beschäftigung mit den Objekten. Ganz so wie das
Öl den Docht durchzieht, so durchziehen die Begehrensdränge
in ihrer Gesamtheit als eine im Körper ausgebreitete Empfindlichkeit,
eben als Wollens- oder Spannungskörper, den
Fleischkörper mit seinen Sinnesorganen.
Und die Flamme dieser brennenden Öllampe, die ja nie
durch den Docht allein, sondern gerade durch sein Durchtränktsein
mit Öl zustande kommt, gilt für das Aufleuchten des
Erlebnisses, also für Gefühl, und der Schein für die Wahrnehmung.
So kommt der Eindruck eines die Umwelt empfindenden,
erlebenden Ich zustande, das diese oder jene angenehmen
oder unangenehmen Erlebnisse hat.
Bei stark herausragendem Docht, wenn also ein großer Teil
des ölgetränkten Dochtes brennen kann, entsteht eine Flamme
mit großem Lichtschein, und bei ganz wenig herausragendem
Docht kann der Lichtschein nur klein bleiben. Je mehr Triebe,
je größer die Spannung, desto stärker ist Gefühl (die Flamme)
und desto leuchtkräftiger die Wahrnehmung (der Schein). Bei
wenigen Trieben entsteht wenig Gefühl und Wahrnehmung
von geringerer Leuchtkraft – und bei Fortfall der Triebe entsteht
kein Gefühl und keine gefühlsgetränkte Wahrnehmung.
Und das würde dem entspechen, was Nyanatiloka sagt.. man kann den so "Ur-grund" von dem "Schmutz " nichts trennen.
Aus: Paul Debes, "Die Lehrreden des Buddha", Band 1, Seite 390 - https://www.buddhistisches-seminar.de/
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Kann sein, ich hatte soeben PD zitiert. Der Robot ("") sagt so oder so über "Mahayna", der weiss es besser ( Ironie).Aber die Begriffe zeigen nicht auf ein Phänomen. Das wird auch explizit erklärt. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch von den meisten Mahayana -Buddhisten als Phänomen, oder "Ding", verstanden wird. Das liegt einfach an der Gewohnheit unseres Geistes, mit einem Begriff benanntes als "Ding" zu begreifen. (Interessant: Be-griff - be-greifen)
Klar, es gibt kein Ding, alles ist als der Prozess des "Fliessens" zu verstehen, so die moderne Physik, die hat immer recht. Es gibt kein "Ding" per se, wer würde das bestreiten? alles ist abhängig entstanden und frei von der innewohenden ( inhärenten) Existenz-Weise. LG.
kilaya
Moderation
Buddh. Richtung:
Dzogchen
Dzogchen
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Die KI generiert eine Essenz aus dem, was sie "gelesen" hat. Die Antwort entspricht meinem eigenen Verständnis - entstanden aus Originaltexten und Kommentarliteratur - bis aufs Wort. Von daher kann ich daraus schließen, dass die KI die Inhalte, mit denen sie trainiert wurde, korrekt herauskristallisiert hat. Einer Aussage, die ich nicht aus eigenem Wissen verifizieren kann, würde ich nicht einfach so vertrauen. Wenn das aber so herauskommt, dann gibt es eine Basis dafür, dann ist das ein Zeichen einer breiten Übereinstimmung der Texte zu diesem Thema.
(Interessant übrigens, dass bei PD oben der Begriff bhava für "Latenz" auftaucht. Latenz ist die Basis des Wissens der KI, bevor sie es in Worte gießt, das ist der Fachbegriff dafür.)
Der Begriff Buddhanatur hat nichts mit Wahrnehmung, nichts mit Gefühl, nichts mit Sinneswahrnehmung zu tun. All diese Zitate sind für sich genommen interessant, ich sehe aber darin nichts, was dem Konzept einer Buddhanatur widerspricht. Dass es überhaupt möglich ist, dass ein Wesen Nirvana erfährt, ist die Buddhanatur. Nirvana ist das Verlöschen der Triebe, des Ich-Wahns. Buddhanatur ist eine Aussage darüber, dass man dieses Ziel erreichen kann. Dass es eine Grundlage dafür gibt, dieses Ziel zu erreichen. Tatsächliche Unterschiede zwischen Theravada und Mahayana sehe ich nicht im Konzept der Buddhanatur.
Sondern in der Art, wie der Zustand des Nirvana erreicht werden kann. Das beinhaltet ein unterschiedliches Verständnis der Vorgänge, die man als Triebe bezeichnet.
Sind die umgewandelten, in ihre elementare Qualität transformierten Triebe aber noch Triebe? Hat man da nicht eigentlich ebenfalls den Trieb aufgelöst? Ist der Zustand frei von Trieben unterschiedlich, wenn man sich von diesen durch Aufgabe oder durch Umwandlung befreit hat? Gibt es zwei verschiedene Zustände frei vom Ich-Wahn, die qualitativ unterschiedliche Nirvanas sind?
Erlebt das Wesen, das Nirvana erreicht hat, nach Aussage des Theravada gar nichts mehr? Diese Fragen kann ich nicht beantworten, bis ich mal da angekommen bin. Aber ich vermute eher, dass es keinen Grund gibt, sich über "richtig" oder "falsch" zu streiten im Diskurs zwischen Theravada und Mahayana.
(Interessant übrigens, dass bei PD oben der Begriff bhava für "Latenz" auftaucht. Latenz ist die Basis des Wissens der KI, bevor sie es in Worte gießt, das ist der Fachbegriff dafür.)
Der Begriff Buddhanatur hat nichts mit Wahrnehmung, nichts mit Gefühl, nichts mit Sinneswahrnehmung zu tun. All diese Zitate sind für sich genommen interessant, ich sehe aber darin nichts, was dem Konzept einer Buddhanatur widerspricht. Dass es überhaupt möglich ist, dass ein Wesen Nirvana erfährt, ist die Buddhanatur. Nirvana ist das Verlöschen der Triebe, des Ich-Wahns. Buddhanatur ist eine Aussage darüber, dass man dieses Ziel erreichen kann. Dass es eine Grundlage dafür gibt, dieses Ziel zu erreichen. Tatsächliche Unterschiede zwischen Theravada und Mahayana sehe ich nicht im Konzept der Buddhanatur.
Sondern in der Art, wie der Zustand des Nirvana erreicht werden kann. Das beinhaltet ein unterschiedliches Verständnis der Vorgänge, die man als Triebe bezeichnet.
Sind die umgewandelten, in ihre elementare Qualität transformierten Triebe aber noch Triebe? Hat man da nicht eigentlich ebenfalls den Trieb aufgelöst? Ist der Zustand frei von Trieben unterschiedlich, wenn man sich von diesen durch Aufgabe oder durch Umwandlung befreit hat? Gibt es zwei verschiedene Zustände frei vom Ich-Wahn, die qualitativ unterschiedliche Nirvanas sind?
Erlebt das Wesen, das Nirvana erreicht hat, nach Aussage des Theravada gar nichts mehr? Diese Fragen kann ich nicht beantworten, bis ich mal da angekommen bin. Aber ich vermute eher, dass es keinen Grund gibt, sich über "richtig" oder "falsch" zu streiten im Diskurs zwischen Theravada und Mahayana.
mukti
Mitglied
Buddh. Richtung:
Theravada
Theravada
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Ich frage mich also, ob die Ablehnung des Begriffs "Buddhanatur" nicht letztlich auf einem falschen Verständnis dieses Konzepts beruht.
Wenn man den Begriff nicht annimmt muss man ihn deshalb nicht ablehnen würde ich sagen. Wahrscheinlich stimmen alle buddhistischen Richtungen darin überein dass der Mensch das Potential zum Erwachen in sich hat, die Bezeichnung "Buddhanatur" gibt es halt im Theravada nicht. Die Bezeichnung für das Erwachen ist Bodhi und das Ziel ist Nibbana. Man könnte sogar sagen dass Nibbana bereits da ist und nur entdeckt werden muss wenn man so will:
"Es besteht, Mönche,
das Ungeborene, Ungewordene,
Ungeschaffene, Unzusammengesetzte.
Wenn dieses Ungeborene, Ungeschaffene,
Unzusammengesetzte nicht bestünde,
- nicht wäre dann ein Entrinnen
aus dem Geborenen, Gewordenen,
Geschaffenen, Zusammengesetzten
zu erkennen.
Weil aber dieses Ungeborene,
Ungewordene, Ungeschaffene,
Unzusammengesetzte besteht, Mönche,
deshalb ist ein Entrinnen für das
Geborene, Gewordene, Geschaffene,
Zusammengesetzte zu erkennen."
Ud.VIII.3
kilaya
Moderation
Buddh. Richtung:
Dzogchen
Dzogchen
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Das wäre wünschenswert. Man erlebt leider oft eine Ablehnung. Ist es denn so, dass Mahayanis des Öfteren erwarten, dass man den Begriff annehmen müsse?Wenn man den Begriff nicht annimmt muss man ihn deshalb nicht ablehnen würde ich sagen.
Letztlich ist es doch so, dass es viele sehr unterschiedliche Begriffe gibt, und dann kommen jeweils noch unterschiedliche Interpretationen und Übersetzungen dazu. Der einzige Diskurs, der in meinen Augen Sinn macht, ist einer, der sich auf die Bedeutung bezieht.
Das wäre auch eine perfekte Definition von "Urgrund" oder "Buddhanatur". Wobei Urgrund sich eher auf äußere Phänomene bezieht, und Buddhanatur auf die Wesen. Letztendlich trennscharf ist das natürlich auch nicht, denn unser körperlicher und geistiger Ausdruck sind am Ende auch Phänomene. (Und vielleicht sind sogar die "äußeren Phänomene" eigentlich auch Ausdruck des Geistes. Aber das führt hier zu weit weg vom eigentlichen Thema ...)das Ungeborene, Ungewordene,
Ungeschaffene, Unzusammengesetzte.
Wenn dieses Ungeborene, Ungeschaffene,
Unzusammengesetzte
Die Begriffe "ungeboren", "ungeschaffen", "unzusammengesetzt" werden in tibetischen Texten auch oft in diesem Kontext verwendet.
mukti
Mitglied
Buddh. Richtung:
Theravada
Theravada
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Nach meiner Wahrnehmung sind manche Theravadins sehr darauf bedacht dass sich nur ja kein Atta-Glaube einschleicht oder auch nur eine Spur von etwas das ewig aus sich selbst heraus bestehen würde. Zudem gibt es seit alters her gewisse Rivalitäten, in Indien gab es wohl immer schon eine Vielzahl verschiedener Schulen. Trotzdem koexistieren bis heute alle weitgehend friedlich nebeneinander und die Auseinandersetzung findet nur argumentativ statt. In Europa haben wir einen anderen historischen Hintergrund, wo durch die Jahrhunderte eine Schule quasi ein staatlich sanktioniertes Monopol innehatte. Vielleicht sind wir ja noch im Lernprozess andere Ansichten bestehen zu lassen ohne erbittert um die "höchste Wahrheit" zu streiten.Das wäre wünschenswert. Man erlebt leider oft eine Ablehnung. Ist es denn so, dass Mahayanis des Öfteren erwarten, dass man den Begriff annehmen müsse?
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Hm, @kilaya , was mir fällt ein.Das wäre auch eine perfekte Definition von "Urgrund" oder "Buddhanatur". Wobei Urgrund sich eher auf äußere Phänomene bezieht, und Buddhanatur auf die Wesen. Letztendlich trennscharf ist das natürlich auch nicht, denn unser körperlicher und geistiger Ausdruck sind am Ende auch Phänomene. (Und vielleicht sind sogar die "äußeren Phänomene" eigentlich auch Ausdruck des Geistes. Aber das führt hier zu weit weg vom eigentlichen Thema ...)
Die Begriffe "ungeboren", "ungeschaffen", "unzusammengesetzt" werden in tibetischen Texten auch oft in diesem Kontext verwendet.
Alle Autoren von Buddh. Seminar , so HH ( Hellmuth Hecker) am ende zitieren Mahayana mit dem reinem Geschmack von "Herz-Sutra ".
Ich stelle mir aber die andere Frage.
Ich lese bei PD, also sinngemäss, ---die Gegebenheit der Triebe stellt die innere Bedingung für das Aufkommen von Gefühl ( so wäre der erste Schritt).
Was man fühlt, das nimmt man wahr( so wäre dann der zweite Schritt)
Und im AX, 58 man liest: " Worin kommen alle Dinge zusammen? Im Gefühl." ( so der dritte Schritt).
Man sollte , denke ich, in Betracht zu ziehen, dass es kein "Ur-grund " war und gibt.
Wenn der Buddha im Kanon redet über "Das Nichts Ungeborene", dann er kann es nichts anders gestalten, denn Nagarjuna war später.
Am "Ende" es spielt keine Rolle, denn von der absoluten Warte aus "es gibt keinen winzigen Unterschied zwischen Samsara und Nirvana", so N.
Aber man sollte immer im Hinterkopf haben, dass es die andere ( wie die höhere) Dimension ist, also der normale Otto sollte weiter praktizieren, denn er ist verblendet, usw... Mahayana Verneint nichts Hinayana, denke ich, so meine eigene meinung, aber die geht tiefer und entwickelt die Grund-Idee weiter.
Am Ende , ich weiss selbst nichst, denn ich hatte auch genug Mahayana zuerst gelesen, ausser Zen und wie jetzt PD und den Buddh. Seminar.
Igor07
Mitglied
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Schaue hier:Ich denke, das größte Missverständnis steckt darin, dass versucht wird, aus einem "Urgrund" oder "Buddhanatur" usw. ein Phänomen zu machen - weil es einen Begriff dafür gibt. Aber die Begriffe zeigen nicht auf ein Phänomen. Das wird auch explizit erklärt. Was aber nicht heißt, dass das nicht auch von den meisten Mahayana-Buddhisten als Phänomen, oder "Ding", verstanden wird. Das liegt einfach an der Gewohnheit unseres Geistes, mit einem Begriff benanntes als "Ding" zu begreifen. (Interessant: Be-griff - be-greifen)
Nach Hans-Peter Dürr ist die Wirklichkeit als ständiger Prozess von Veränderungen zu verstehen. Ihre Umschreibung liegt ausserhalb von Begrifflichkeiten, währenddessen sich die Realität als die beschreibbare, stoffliche Welt auszeichnet. Die Materie kann als geronnene Beziehung verstanden werden. In Wirklichkeit würden wir aber mehr erleben, als wir „be-greifen“ und kategorisieren können. Auch einer der Begründer der Quantenmechanik, Erwin Schrödinger warnte uns davor, Atome und Teilchen materialisieren zu wollen: „Es ist besser, sich Teilchen nicht als dauerhafte Einheiten vorzustellen, sondern eher als Augenblickereignis. Mitunter formen diese Ereignisse Ketten, welche die Illusion erwecken, dass wir es mit einem dauerhaften Objekt zu tun haben.“ [2]

Gott und die Quantenphysik | RefLab
Über die Messbarkeit der Wirklichkeit und die Grenzen unserer Wahrnehmung.
kilaya
Moderation
Buddh. Richtung:
Dzogchen
Dzogchen
Re:
Theravada Über Buddha-Natur im Theravada, Die Frage
Wen in der Quantenphysik davon die Rede ist, dass Quanten keine Teilchen sind, ist das allenfalls eine halbwegs brauchbare Analogie. Im Übrigen ist der Diskurs in der Hinsicht noch in vollem Gange und die Quantenverschränkung wird von vielen inzwischen so interpretiert, dass man damit nicht mehr so argumentieren könnte, in Bezug auf buddhistische Vorstellungen, wie in letzter Zeit oft üblich. Dann müsste sich der Buddhismus eine andere Analogie suchen 
Leider nur auf Englisch, das Thema ist auch wirklich komplex, aber ich poste es dennoch mal:
(Es gibt deutsche Untertitel, die nicht bloß autogeneriert sind)
Deutsche Zusammenfassung:

Leider nur auf Englisch, das Thema ist auch wirklich komplex, aber ich poste es dennoch mal:
Deutsche Zusammenfassung:
In diesem Video geht es darum, warum die Quantenmechanik als nicht-lokal betrachtet wird. Der Sprecher beginnt damit, die Bedeutung von Lokalität zu erklären, die besagt, dass Interaktionen nur mit nahegelegenen Dingen stattfinden können. Dann erklärt er die Grundlagen der Quantenmechanik, insbesondere die Wellenfunktion und den Kollaps der Wellenfunktion bei Messungen. Er betont, dass der Kollaps der Wellenfunktion eine nicht-lokale Eigenschaft der Quantenmechanik ist.
Der Sprecher erwähnt auch das Konzept der verschränkten Teilchen und zeigt, dass die Quantenmechanik nicht die Messung eines Teilchens beeinflusst, sondern die Korrelationen zwischen verschränkten Teilchen. Dies führt zur Diskussion von Bells Theorem, das besagt, dass entweder die Realität nicht lokal oder nicht deterministisch ist, basierend auf den Experimenten von Bell und der Verletzung seiner Ungleichungen.
Schließlich erwähnt der Sprecher die Möglichkeit von Modellen mit versteckten Variablen, die die Quantenmechanik lokal reproduzieren können, aber die Messunabhängigkeit verletzen. Er weist darauf hin, dass einige Physiker dieses Thema möglicherweise vermeiden, da es alternative Interpretationen der Quantenmechanik infrage stellt.
Insgesamt untersucht das Video die Nicht-Lokalität in der Quantenmechanik und die verschiedenen Interpretationen und Modelle, die dieses Konzept zu erklären versuchen.
Welche beiden Formen von Nicht-Lokalität werden beschrieben?
Im Video werden zwei Formen von Nicht-Lokalität beschrieben:
- Physische Nicht-Lokalität: Dies bezieht sich auf eine Form der Nicht-Lokalität, bei der es eine unmittelbare Aktion aus der Ferne gibt, bei der etwas augenblicklich von einem Ort zum anderen zu gelangen scheint, als ob es durch ein Portal gehen würde.
- Nicht-Lokale Korrelation: Dies bezieht sich auf eine andere Form der Nicht-Lokalität, bei der es eine Korrelation zwischen entfernten Ereignissen gibt, die sich über eine Entfernung erstreckt. Dies bedeutet, dass Informationen über ein Ereignis an einem Ort Rückschlüsse auf ein anderes Ereignis an einem anderen Ort ermöglichen, ohne dass eine direkte Aktion aus der Ferne stattfindet. In dieser Form der Nicht-Lokalität sind die physischen Veränderungen jedoch lokal und finden an den jeweiligen Orten statt.
Zuletzt bearbeitet:
